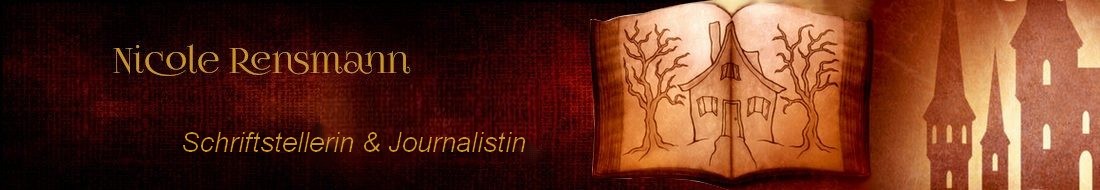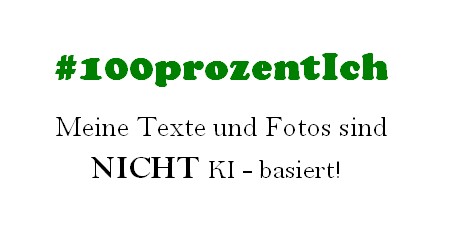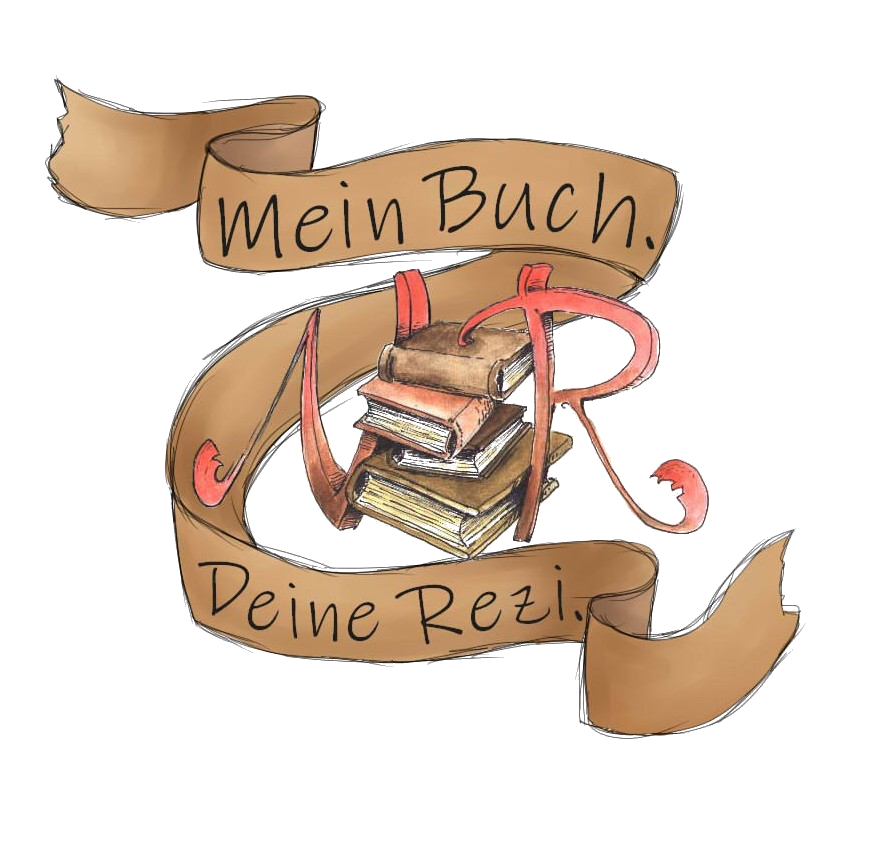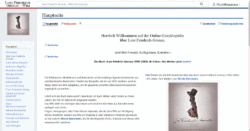Er gehört zu den deutschen Autoren, die es verstehen mit jedem neuen Roman eine größere Zielgruppe zu erreichen. Auch mit seinem aktuellen Werk dürfte dem in Frankreich lebenden Andreas Eschbach nicht nur in dieser Hinsicht ein neuer Coup geglückt sein. Wenige Wochen vor der tatsächlichen Verleihung des Nobelpreises, mit dem in diesem Jahr auch der deutsche Physiker Theodor Hänsch ausgezeichnet wird, erschien Andreas Eschbachs Roman »Der Nobelpreis«. Wer auf Science Fiction – Elemente wie in »Das Jesus Video« oder »Die Haarteppichknüpfer« hofft, wird allerdings enttäuscht.
Schon der Titel gibt Auskunft über den Inhalt des 555 Seiten langen Romans, und so erfährt der Leser zunächst einiges rund um die Zeremonie der Nobelpreisverleihung. Doch der Autor schaut hinter das Geschehen und bringt zur Sprache, worüber Mancher bisher nur zu spekulieren wagte.
Ein Mitglied des Nobel-Komitees wird bestochen, als dieser ablehnt, wird seine 14-jährige Tochter entführt. Sein einziger Ausweg scheint der verhasste, im Gefängnis sitzende Schwager zu sein. Befand sich der Leser bis hierher noch im Kopf von Hans-Olof Andersson, wechselt der Autor nun die Perspektive und die Geschichte wird – bis auf eine kurze Ausnahme – von eben diesem Schwager Gunnar Forsberg in der Ich-Form erzählt. Dem Anschein nach ist Gunnar einem der größten Skandale und einer Verschwörung auf der Spur, in die beinahe jedes Mitglied des Nobelkomitees verstrickt sein soll, genauso wie die Polizei und weitere Persönlichkeiten.
Mehrfach entkommt er der Polizei durch kleine Tricks, stets mit nur einem Ziel: Seine Nichte zu finden, die ihm – obwohl er keinerlei Beziehung mehr zu ihr hatte – so viel bedeutet, weil sie die Tochter seiner verstorbenen, innig geliebten Schwester ist.
Eine Frau ist es schließlich auch, die ihm den bedeutenden Tipp in diesem Spiel um Entführung, Mord und Korruption gibt. Das Ende überrascht – und überrascht auch wiederum nicht. Aber mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden.
In dem Roman »Der Nobelpreis« gibt es einige ziemlich radikale Schnitte und Perspektivenwechsel. Was hat dich dazu bewogen?
Es ist ziemlich schwierig, darüber zu reden, ohne zuviel von der Geschichte preiszugeben. Aber ich glaube, wenn man das Buch gelesen hat, wird man in der Rückschau ziemlich leicht verstehen, warum gerade diese Erzählweise notwendig war: Die Geschichte ließe sich auf andere Weise schlicht nicht erzählen.
Der Nobelpreis ist nicht nur ein Thriller, sondern eine Verschwörungsstory in großem Stil, die zumindest teilweise auf Tatsachen beruhen soll. Aber du klagst in diesem Buch weitaus mehr an, auch wenn sich manches später als falsche Fährte entpuppt. Willst du dem Leser auf der einen Seite die Augen dafür öffnen, wie viel Korruption und Wahnsinn es auf dieser Welt gibt, auf der anderen aber auch darauf hinweisen, dass längst nicht hinter allem Übel eine Verschwörung stecken muss?
Ach, ich glaube, was das »Augen öffnen« anbelangt, leisten die täglichen Nachrichten schon ganze Arbeit – vielleicht sogar zuviel davon. Nein, im Grunde habe ich versucht, in diesem Roman das Thema der Arbeiten von Sophia Hernandez Cruz abzubilden: Wir haben einen Anteil daran, wie wir die Welt sehen. Wir sind nicht nur Opfer von Umständen. Wenn die Welt ein Schachbrett wäre, würden die einen schwarze Quadrate vor einem weißen Hintergrund sehen, die anderen weiße Quadrate vor einem schwarzen Hintergrund. Was davon ist richtig? Das sollte so ein bißchen mitschwingen. Gunnar verkörpert eine bestimmte Haltung, die man, glaube ich, sowohl gut nachvollziehen als auch gut durchschauen kann.
Wie stehst du zu diesen Themen? Wie sehr glaubst du an diese und ähnliche Verschwörungen?
Was ich in meiner Unternehmerzeit selber erlebt habe ist, daß es Kungelei gibt, Seilschaften, Korruption, Intrigen hinter den Kulissen und so weiter; man kann mit Sicherheit davon ausgehen, daß alle offiziellen Darstellungen und Erscheinungen von was auch immer geschönt, bearbeitet und inszeniert sind. Aber an so richtige Verschwörungen zu glauben, sowas in der Preisklasse »Bilderberger« oder »Freimaurer« oder dergleichen, das will mir nicht recht gelingen. Hunderte oder Tausende von Leuten, die alle dicht halten? Man braucht bloß mal eine Surprise Party mit zehn Leuten zu organisieren, um solche Szenariern schlicht für inkompatibel mit der menschlichen Psyche zu halten.
Obwohl, andererseits weiß man natürlich nie… (grinst). Für Autoren sind Verschwörungstheorien natürlich auf alle Fälle tolle Anregungen. Mein herzlicher Dank deshalb deshalb an dieser Stelle an alle Verschwörungstheoretiker! Ohne Euch gäbe es eine Menge aufregender Bücher nicht.
Schon mit »Der letzte seiner Art« hast du dich in Richtung Mainstream bewegt. In »Der Nobelpreis« findet sich nun keine Andeutung von Phantastischem oder Science Fiction mehr. Obwohl du nie gern über Inhalte deiner zukünftigen Romane sprichst, erlaube mir bitte dennoch folgende Frage: Kannst du absehen, ob du auch für den Erwachsenen wieder Science Fiction schreiben wirst? Oder willst du nun eher den Bereich Thriller festigen und ausbauen?
Was ich schreibe, hängt immer davon ab, welche Grundidee mich gerade fasziniert. In welche Schublade man das dann tut…? Das sollen andere entscheiden. Im Moment habe ich das Gefühl, daß meine Science-Fiction-Ader vielleicht mit der »Marsprojekt«-Pentalogie ausgelastet ist. Wenn die mal fertig ist, sieht man sicher weiter. Ideen habe ich jedenfalls noch zur Genüge, keine Sorge.
Allerdings geht es mir so, daß mich in der momentanen Science-Fiction wenig fasziniert. Jeschkes »Cusanusspiel« war ein Hammerbuch, aber das ist ein Solitair, die Quintessenz eines Lebens, sowas findet man so schnell nicht wieder. Und ansonsten… fällt mir gerade nichts ein. Sowas spielt natürlich auch eine Rolle.
Deine Beschreibungen für das Nobelbankett sind sehr detailliert – sie erinnern ein wenig an die legendären »Traumschiff«-Diners. Hast du dich zu einem dieser Abende einladen lassen oder wie hast du für dieses Abendessen bzw. andere Einzelheiten der Nobelpreisverleihung recherchiert?
Nein, sich zum Nobelbankett einladen zu lassen ist nahezu unmöglich. Und unnötig, wenn man nur darüber schreiben will. Es gibt genügend Literatur darüber, inzwischen kann man sogar die Menüs aller Bankette im Internet abfragen, die es je gegeben hat. Das ging ein paar Wochen, nachdem ich mühsam die Menüfolge des Banketts 1999, als Grass den Nobelpreis bekam, ermittelt hatte, online.
»Letztendlich ist der Nobelpreis auch nur ein Preis.« Eine Aussage, die du Sofía Hernández Cruz in den Mund gelegt hast, die aber – bezogen auf die nicht ganz so hoch dotierten Literaturpreise, die deine eigenen Werke bisher einheimsen konnten – auch deine persönliche Meinung sein könnte?
Ja, das denke ich mittlerweile tatsächlich. Wenn man sich alles wegdenkt, was Glanz, Gloria und Brimborium – Marketing also – ist, dann ist auch der Nobelpreis einfach nur ein Preis. Eine Versammlung, eine Laudatio, eine Medaille, eine Urkunde, ein Händedruck und so weiter. Und eine Menge Geld, natürlich.
Wobei man am Nobelpreis überdies kritisieren muss dass sich die geübte Praxis weit entfernt hat von dem, was Nobel wollte, nämlich Forscher und Literaten zu fördern. Tatsächlich kommen praktisch alle Auszeichnungen heutzutage viel zu spät, um noch etwas anderes zu sein als Preise für abgeschlossene Lebenswerke; gefördert wird dadurch jedenfalls niemand mehr. Es ist eher so eine Art Aufnahme in einen imaginären Olymp geworden.
Andreas Eschbach
»Der Nobelpreis«
Gustav Lübbe Verlag
ISBN 3785722192
22,95 Euro
555 Seiten
Webtipps
Die Website des Autors
Interview mit Andreas Eschbach »Der Xillionen Dollar-Mann«, 2004
Rezension »Das Buch von der Zukunft«
Print-Tipps
Immer wieder lesenswert: Andreas Eschbachs Kolumne im Magazin phantastisch!
© Text: Nicole Rensmann